
Diagnose
Eine frühe Diagnose des Morbus Parkinson ist herausfordernd, da es keine Biomarker, Bildgebung des ZNS oder klinische Tests gibt, die die Diagnose eindeutig bestätigen. Die PD Diagnose basiert derzeit auf dem Vorhandensein oder Fehlen verschiedener klinischer Faktoren und Erfahrung des behandelnden Arztes.
Die Anzeichen und Symptome, die in der frühen Phase der Parkinson-Erkrankung auftreten, entsprechen einer Vielzahl von Bewegungsstörungen, speziell anderen Formen des Parkinson-Syndroms, wie zum Beispiel Multisystematrophie, medikamenteninduzierter Parkinsonismus, vaskuläres Parkinsonsyndrom, Lewy-Körper-Demenz oder essenzieller Tremor. Dennoch kann eine ziemlich präzise Diagnose des idiopathischen Parkinson-Syndroms (IPS) durch klinische Eigenschaften und das Ansprechen auf Antiparkinson-Medikamente von einem Bewegungsstörungsspezialisten gestellt werden (Pahwa et al., 2010).
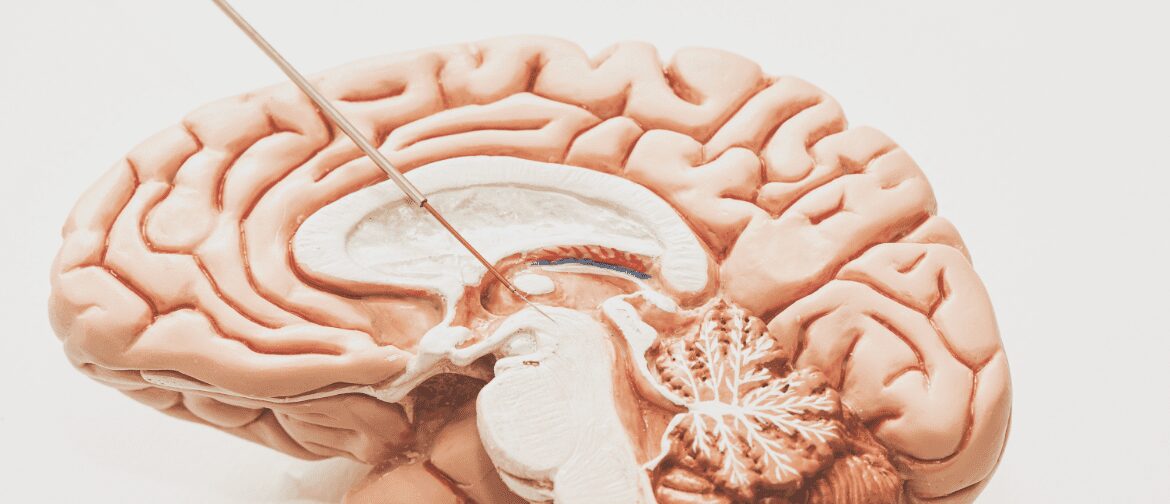
Symptome und Verlauf
Normalerweise sprechen Patienten in der frühen Phase der Behandlung sehr gut auf Levodopa an. Im Verlauf der Erkrankung beginnt die Wirkung von Levodopa abzunehmen („Wearing-off“). Dies ist unter anderem durch den Verlust der so genannten Pufferkapazität des Gehirns begründet. Zu Beginn der Erkrankung können die Patienten die im Tagesverlauf starken Levodopaschwankungen kompensieren, indem sie das aus Levodopa gewonnene Dopamin im Striatum speichern und bei Bedarf freisetzen. Diese Pufferwirkung ermöglicht eine weitestgehend gleichmäßige Freisetzung und somit eine konstante klinische Wirkung. Mit Fortschreiten der Erkrankung verfügt das Striatum jedoch über eine immer geringere Anzahl von Neuronen, die Dopamin speichern können – das Gehirn verliert seine Pufferkapazität. Infolgedessen gehen Schwankungen im Plasmaspiegel mit Wirkstofffluktuationen durch die relativ kurze Halbwertszeit von Levodopa und die ungleichmäßige Resorption der Medikation einher. Dies äußert sich bei den Patienten in der moderaten und fortgeschrittenen Phase des Morbus Parkinson durch „Wearing-off-Symptome“ und Dyskinesien.
Daher wird angenommen, dass die intermittierende oder pulsatile Stimulation der dopaminergen Rezeptoren für die Entwicklung von Motorfluktuationen und Dyskinesien verantwortlich ist und dadurch die Langzeitbehandlung mit Levodopa erschwert (Nutt et al., 2000).
VERÄNDERUNGEN IM ANSPRECHVERHALTEN AUF LEVODOPA MIT ZUSAMMENHANG KRANKHEITSVERLAUF PARKINSON
Quelle: (Medscape, 2016)
Motorfluktuationen treten in der moderaten/mittleren und fortgeschrittenen Phase des Morbus Parkinson auf (siehe Graphik). Diese sind durch das “End-of-dose” Phänomen oder das “Wearing-Off” charakterisiert, weshalb die Patienten die Intervalle zwischen den oralen Einnahmezeitpunkten verkürzen müssen (Olanow et al., 2001).
Motorkomplikationen treten bei ungefähr 50% bis 90% der Patienten mit Morbus Parkinson auf, die 5 bis 10 Jahre Levodopa erhalten haben. Diese stellen das Hauptproblem der Aktivitätseinschränkung dar. Die Symptome sind besonders unter Patienten mit Young-Onset PD verbreitet und scheinen häufiger bei hohen Dosen von Levodopa aufzutreten. Zusätzlich zu den bekannten Nebenwirkungen von Levodopa sind die Patienten von „On- und Off“ Phasen betroffen. Während der „Off“ Phasen sind die Patienten nicht in der Lage ihre motorischen Funktionen zu steuern. Während der „On“ Phasen ist die motorische Fähigkeit vorhanden und die Plasmakonzentration von Levodopa ist optimal. Dyskinesien (unwillkürliche Bewegungen) dürften auf hohe Konzentrationen von Levodopa im Plasma zurückzuführen sein.
Behandlungsmöglichkeiten
Die Behandlungsmöglichkeiten starten, abhängig vom Alter des Patienten, entweder mit Levodopa und/oder Dopaminagonisten. In der moderaten / mittleren Phase werden zusätzliche Therapien herangezogen. Sehr häufig wird eine Kombination aus zwei oder mehreren nachstehenden Therapien angewandt: Levodopa, Dopaminagonisten, COMT-Inhibitoren, optional MAO-B-Inhibitoren und / oder Anticholinergika. Die fortgeschrittene Phase ist oft schwierig in der Behandlung, da zusätzlich „Off“ Phasen und Levodopa-induzierte Dyskinesien auftreten. Zusätzlich zu den Motorfluktuationen können kognitive oder psychische Symptome auftreten (Chaudhuri et al., 2013).
In der fortgeschrittenen Phase der Parkinson-Erkrankung ist das therapeutische Ziel die kontinuierliche dopaminerge Stimulation (CDS). Neben intermittierenden subkutanen Apomorphin-Injektionen und der Tiefenhirnstimulation werden kontinuierliche Infusionstherapien mit Apomorphin oder enterales Levodopa in Betracht gezogen.
Mehrere Berichte und klinische Studien haben gezeigt, dass wenn der Verlust des physiologischen Dopamins durch Levodopa kompensiert wird, die resultierende pulsatile Stimulation die aktivierende Wirkung der Basalganglien vermindert und es daher zu Komplikationen wie Motorfluktuationen und Dyskinesien kommt. Basierend darauf stellt die kontinuierlichen Arzneimittelabgabe (CDD) eine wichtige Strategie in der Regulierung der therapeutischen Wirksamkeit für neuartige Antiparkinson-Medikamente dar (Rascol, 2011).
Die kontinuierliche Infusion eines Dopaminagonisten ist herausfordernd für Patient und Betreuer. Dennoch vermeidet diese die Notwendigkeit für eine Tiefenhirnstimulation und bietet Vorteile, die mit invasiven Behandlungen vergleichbar sind (Stocchi, 2008).
Leitlinien (EN)
Early
Parkinson’ s
disease
Late
Parkinson’ s
disease
Parkinson’s
disease in
over 20s
An algorithm
for the PD
management
Practice
Parameter:
Treatment
Treatment
with
Apomorphine
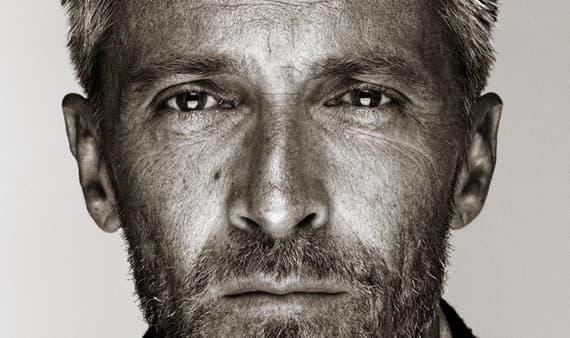
Über Dacepton®
Der potente, nicht-ergoline, nicht-selektive und direkt wirkende Dopamin-Rezeptor-Agonist.

Patienten Einstellung
Erfahren Sie mehr darüber, was zu beachten ist, über die Schnelltitration und Formen der Verabreichung.
Quellen
Pahwa et al., 2010
Nutt et al., 2000
Medscape, 2016. New Insights Into the Effective Management of Levodopa-associated Motor Complications
Olanow et al., 2001
Chaudhuri et al., 2013
Rascol, 2011
Stocchi, 2008